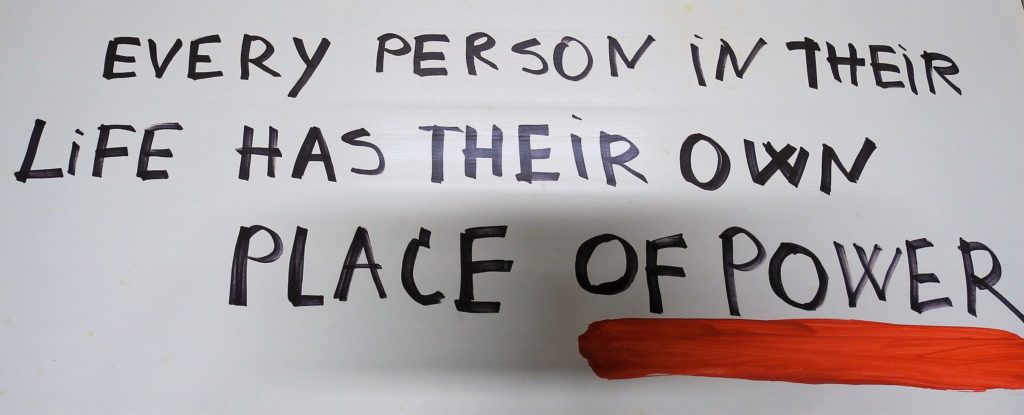Fast leer ist die Eingangshalle im „Znaki Czasu“, dem Toruńer „Zentrum für Zeitgenössische Kunst“, als es an diesem Julidienstag für die Ausstellung „The Cleaner“ öffnet, für über 100 Kunstwerke von Marina Abramović aus über fünf Jahrzehnten. Hier begegne ich ihnen das erste Mal unmittelbar. Toruń ist die vorletzte Station einer Retrospektive, die zuvor in Schweden (Stockholm), Norwegen (Humlebæk), Dänemark (Høvikodden), Deutschland (Bonn) und Italien (Florenz) zu sehen war.
Ist dieser Auftakt ent-täuschend? Ja! Denn er täuscht nicht über die Wenigen hinweg, die die Kunst dieser Künstlerin interessiert. Denn genau um diese Wenigen geht es. – Wie in der biblischen Erzählung, in der Gott in Gestalt dreier Engel bei Abraham erscheint, um ihm zu verkünden, dass er die der Sünde anheim gefallenen Städte Sodom und Gomorra, bevor er sie zerstört, verschonen will, wenn sich in ihnen zehn anständige Menschen finden. Nur zehn!
Zehn sind es in Toruń 30 Minuten nach Zwölf noch nicht, aber sie finden sich: ahnungslos, dass ein großes Ganzes auf dem Spiel steht, das allein mit ihnen natürlich nicht zu machen ist. Nicht zu behalten. Nicht zu beschützen. Aber als Zeichen und Inspiration. Und sie werden inspiriert, hier und heute von Marina Abramović, die das ihre schon getan hat.
In ihrem Schoß liegen ihre Hände deswegen noch nicht. Weiter ermutigen sie mit dem, was sie an Augenweiden schaffen, die keine Paradiese wurden, sind und werden können, sondern vor allem schmerzhafte Einlassungen in eine Wirklichkeit mit akutem Zukunftsmangel. Der/dem sich anders nicht beikommen lässt? Das aber ist ihre Frage nicht.
Ihr geht es um schonungslose Reinigung als das Gegenteil von Reinwaschung oder der der eigenen Hände in Unschuld. Ihr geht es um eine Klärung der Umstände im Sinne von Aufklärung und um Klarheit im Sinne von Einsicht in die Verhältnisse. Der inneren Verhältnisse und der, die ich mit meinem Verstand zu durchschauen verpflichtet bin. Dazu ‚verdammt‘ sagen die, die begriffen haben, was ‚Sache ist‘. Aber nur so kann er sein, der Fortschritt, mit dem ich irgendwo ankommen will!
So taucht die Meisterin der Performance in meinem Rundgang auf und fädelt sich nach und nach in das Muster in meinem Kopf, dringt in es ein, bis ich die Chronologie zugunsten meiner Neugier verlasse, um mich – ich dachte, ich wäre hellwach – noch einmal zu wecken: für Wahrnehmungen jetzt, die über das Jetzt hinausreichen.
Bis ich auf dem Stuhl sitze, auf dem sie 2010 im New Yorker „MoMa“ drei Monate oder 600 Stunden lang mit der Performance „The Artist is Present“ Blicke aus aller Welt in ihren eigenen zog – nur auf den ersten Blick keine der schmerzhaften Torturen, denen sie sich bis dahin schon ausgesetzt hatte – eine leibhaftige Mutprobe ohne Wortwechsel und Berührungen und zugleich ein Weg in eine Balance, wie sie nur aus der Wechselwirkung zweier konzentrierter Gegenüber möglich ist: für ein fortwährendes Erstaunen, Erschrecken, Entdecken.
„Ich sitze an einem kleinen Tisch, der Stuhl mir gegenüber ist leer, jeder kann sich dort hinsetzen und mir in die Augen schauen, so lang wie er will, drei Minuten oder drei Stunden. Es wird nur den Blick geben. Ich werde nicht reden, ich werde mich nicht bewegen und noch nicht mal aufs Klo gehen. Schauen Sie, hier unter der Sitzfläche dieses Stuhls gibt es eine Klappe und darunter eine Plastikschüssel, für den Fall, dass ich pinkeln muss.“
Bis ich in ihrem „Manifest“ lese: „Ein Künstler sollte weder sich selbst noch andere belügen. Ein Künstler sollte keine Kompromisse eingehen. Ein Künstler muss in seinem Werk Raum für Stille schaffen. Die Stille ist wie eine Insel inmitten eines aufgewühlten Meeres. Ein Künstler muss sich Zeit nehmen und lange Phasen der Einsamkeit auf sich nehmen. Einsamkeit ist extrem wichtig. Ein Künstler sollte sich lange an Wasserfällen aufhalten. Ein Künstler sollte sich lange an Vulkanen aufhalten, die ausbrechen. Ein Künstler sollte lange schnell fließende Flüsse betrachten. Ein Künstler sollte lange den Horizont betrachten, die Stelle, an der Himmel und Meer sich treffen. Ein Künstler sollte lange die Sterne des Nachthimmels betrachten.“
Bis ich endlich weiß, was ich von einem gewissen Goethe längst hätte wissen können: „Man erblickt nur, was man schon weiß und versteht.“
Letzte Station der Werkschau wird Belgrad sein, die Hauptstadt Jogoslawiens, in der die Tochter serbischer Partisanen ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieges geboren wurde. In Belgrad studierte sie von 1965 bis 1970 Malerei und verließ, sich folgend, Stadt und Land 1976. „Jetzt, fast ein halbes Jahrhundert später, möchte ich vor allem der neuen Generation zeigen, was ich all die Jahre gemacht habe. Ich möchte, dass meine Arbeit sie spüren lässt, wie wichtig es ist, Risiken einzugehen und große Träume zu haben, egal was passiert.“